Die Geschichte der Biedermeiergitarre
1 Die Entstehung der sechssaitigen Gitarre in Neapel

Über die Entstehung der sechssaitigen Gitarre sind wir dank der Forschungsarbeiten von Thomas F. Heck, James Tyler und Paul Sparks gut informiert: Die älteste im Original erhaltene Gitarre, die nicht mehr mit Chören, sondern mit fünf einzelnen Saiten bespannt war, wurde 1774 von Ferdinando Gagliano (1724–1781) in Neapel gebaut (Heck 1972). Die ältesten unverändert erhaltenen sechssaitigen Gitarren stammen von den Neapolitanern Antonio Vinaccia und Giovanni Battista Fabricatore (1750-1812) aus dem Jahr 1785. Möglicherweise wurde eine sechssaitige Gitarre mit dem Zettel "Gaetano Vinaccia, Napoles, anno 1779" schon früher gebaut. Der Zettel könnte jedoch von dem berüchtigten italienischen Händler Leopoldo Franciolini (1844-1920) gefälscht worden sein (Tyler/Sparks 2002, S. 219). Die älteste unveränderte sechssaitige Gitarre, die sicher auf das Jahr 1791 datiert werden kann, stammt nach Thomas F. Heck von Giovanni Battista Fabricatore (Heck 1970, Bd. 1, S. 45f.).
Aufgrund des historischen Befundes lässt sich mit Sicherheit sagen, dass die sechssaitige Gitarre in den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts in Neapel erfunden wurde. Das bedeutet nicht, dass sie zu dieser Zeit in Italien allgemein verbreitet war. Der aus Neapel stammende Gitarrist Federico Moretti (1769-1839) erinnerte sich in seinen "Principios para tocar la guitarra de seis órdenes" (1807) daran, dass 1792 in Italien fast ausschließlich die fünfchörige Gitarre in Gebrauch war: "Obwohl ich die Gitarre mit sieben einfachen Chören benutze, schien es mir angemessener, diese Prinzipien an die Gitarre mit sechs Chören anzupassen, da diese in Spanien allgemein gespielt wird: Derselbe Grund zwang mich, sie im Jahre 1792, angepasst an die Gitarre mit fünf Chören, in italienischer Sprache zu drucken; denn zu jener Zeit war in Italien nicht einmal die [Gitarre] mit sechs [Chören] bekannt" (Moretti 1799, S. 1 Anm. übers.).
Fragt man sich, warum die sechssaitige Gitarre in Neapel und nicht in ihrem Ursprungsland Spanien entwickelt wurde, so findet man eine erste Antwort in der Geschichte der Stadt und des Königreichs Neapel. Von 1501 bis 1713 war das Königreich Neapel eine Provinz des spanisch-habsburgischen Weltreichs und wurde von spanischen Vizekönigen regiert. Die Spanier brachten ihre Kultur und ihr Nationalinstrument, die Gitarre, mit. Infolgedessen entstand im 17. Jahrhundert eine umfangreiche Literatur für die Barockgitarre. In Neapel wurde auch eine italienische Variante der Barockgitarre entwickelt, die Chitarra battente, die zur Begleitung von Liedern und Tänzen verwendet wurde. Sie wurde mit einem Plektrum "angeschlagen" (battere) und hatte im Gegensatz zur spanischen Barockgitarre fünf Chöre mit Stahlsaiten. In der Stadt Neapel wurde die Gitarrenkultur bis ins 19. Jahrhundert besonders gepflegt. So heißt es in einem 1805 erschienenen Artikel über den Zustand der Musik in Neapel: „Die Kultur der Instrumente ist hier, in der Regel, Nebensache; und kein Instrument wird so kultivirt, als - die Guitarre. Wahr ist es indessen, es giebt hier brave Komponisten für dies kleine Wesen, und treffliche Virtuosen, in einem höhern Sinn, als man bey der Guitarre vermuthen sollte, auf derselben. Die Liebhaberey zu befriedigen, hat man unzählbare Lehrer, und zwey Fabriken, die Guitarren aller Art verfertigen. - Dass man hier mehrere Fabriken hat, die die besten Saiten in der Welt verfertigen, und sie in alle Länder versenden, ist bekannt“ (AMZ 7/1805, Sp. 569f.).
Der italienische Ursprung der sechssaitigen Gitarre wird durch zeitgenössische Quellen bestätigt. Der Weimarer Hofinstrumentenmacher Jacob August Otto (1760-1829) geht in seiner Abhandlung "Ueber den Bau der Bogeninstrumente" (1828) näher auf die Herkunft des Instruments ein: "Dieses Instrument ist aus Italien zu uns gekommen. Im Jahre 1788 brachte die Herzogin Amalia von Weimar die erste Guitarre von da mit nach Weimar, und sie galt damals als ein neues italienisches Instrument. Es erhielt sogleich allgemeinen Beifall. Vom Herrn Kammerherrn von Einsiedel bekam ich den Auftrag, für ihn ein gleiches Instrument zu verfertigen. Nun mußte ich noch für viele andere Herrschaften dergleichen machen, und bald wurde die Guitarre in mehreren großen Städten, in Dresden, Leipzig, Berlin bekannt und beliebt. Von dieser Zeit an hatte ich zehn Jahre hindurch so viele Bestellungen, daß ich sie kaum befriedigen konnte. Dann aber fingen immer mehr Instrumentenmacher an, Guitarren zu verfertigen, bis sie endlich fabrikmäßig in großer Anzahl gemacht wurden, z. B. in Wien, Neukirchen und Tyrol. Jene erste italienische Guitarre wich aber von den jetzigen ab, denn sie hatte nur 5 Saiten, und bloß eine besponnene Saite, nämlich das tiefe A" (Otto 1828, S. 94f.). Auch wenn die Behauptung, die Herzogin Anna Amalia (1739-1807) habe "die erste Guitarre" nach Deutschland gebracht, sicherlich übertrieben ist, bestätigt der von Otto verfasste Text die italienische Herkunft des Instruments. Außerdem geht aus dem Bericht eindeutig hervor, dass es sich bei der Gitarre, die Anna Amalia von ihrer Italienreise (1788-1790) mitbrachte, um eine fünfsaitige Gitarre handelte.
Als im 18. Jahrhundert in Italien die Barockmusik von der galanten Musik verdrängt wurde, passte man das Instrument den neuen musikalischen Anforderungen an und ersetzte die fünf Chöre der Gitarre durch fünf Saiten. Ab den späten 1770er Jahren wurde die fünfsaitige Gitarre immer beliebter. Für einige Spieler war sie noch im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts attraktiv (Soattin 2021, S. 1). Bezeichnend ist die Aussage des französischen Gitarristen Charles Doisy: "Diese Beobachtungen veranlassen mich zu der Bemerkung, dass ich erst vor wenigen Tagen ein konzertantes Potpourri ... aufgeführt habe und die Zuhörer ... mir sagten, sie hätten noch nie eine schönere Musik gehört; was mir auch jedes Mal gesagt wurde, wenn ich es aufgeführt habe. Und doch hat meine Gitarre nur fünf Saiten" (Doisy 1801, S. 70 übers.).
Ein entscheidender Katalysator für die Entwicklung der sechssaitigen Gitarre war die Erfindung der Lyragitarre, die um 1780 in Frankreich aufkam und in der napoleonischen Ära zum Modeinstrument avancierte (Tyler/Sparks 2002, S. 220). Das mit sechs Saiten bespannte Instrument trug wesentlich dazu bei, dass die sechssaitige Gitarre schließlich der fünfsaitigen vorgezogen wurde. So stellte J. F. Scheidler in seiner "Nouvelle Methode" (1803) fest: "Die GUITARRE hat nur 5 Saiten, die 6te gehört eigentlich der LEIER" (Scheidler 1803, S. 2).

Jacob August Otto schrieb die Erfindung der sechssaitigen Gitarre dem Dresdner Hofkapellmeister Johann Gottlieb Naumann (1741-1801) zu: "Vor ungefähr dreißig Jahren erhielt der Herr Capellmeister Naumann in Dresden eine Guitarre dieser Art mit 5 Saiten. Bald nach Empfang derselben forderte er mich dazu auf, daß ich eine Guitarre für 6 Saiten einrichten, und noch eine Saite für das tiefe E anbringen möchte" (ebd. S. 95). Die neue sechssaitige Gitarre "erwarb sich schnell überall viele Gönner, da sie für Jeden, der singelustig und singefähig ist, das angenehmste und leichteste Accompagnement abgiebt, überdieß auch leicht transportabel ist. Aller Orten sah man die Guitarre in den Händen der angesehensten Herren und Damen" (ebd. S. 95f.).
Friedrich Schillers Briefwechsel mit dem Dresdner Schriftsteller Christian Gottfried Körner (1756-1831) bestätigt Ottos Darstellung. Körner wandte sich an Schiller mit der Bitte seiner Frau Minna, bei Otto eine Gitarre zu bestellen: "Noch eine Bitte an Dich von M. In Jena ist jetzt ein gewisser Instrumentenmacher Otto, der spanische Zithern oder Guitarren verfertigt, und sich sonst in Gotha aufgehalten hat. Von diesem wünscht meine Frau bald eine Guitarre zu haben. Sei so gut sie zu kaufen oder zu bestellen" (an Schiller, 21.01.1797 S. 243f.). Schiller kam der Bitte nach und suchte Otto auf: "Den Instrumentenmacher Otto, von dem Du schreibst, haben wir lange nicht ausfindig machen können, weil man ihn nicht erlaubt hat, sich hier niederzulassen. Endlich ist er wieder hier angekommen und hat sich beim dermaligen Prorector Grießbach abermals um den Schutz der Universität gemeldet; bei dieser Gelegenheit hab ich ihn aufgefunden und die Guitarre bestellt. Unter 10 Thalern läßt er sie aber nicht; er sagt, daß er für diesen Preis 2 nach Dresden geliefert habe, ich glaube, an Naumann und an die Brühl. In 14 Tagen verspricht er sie zu liefern" (an Körner, 07.02.1797). Otto wollte wissen, "ob die Guitarre zu 5 oder zu 6 Saiten seyn soll" (an Körner, 13.02.1797). Körner entschied sich für "eine Guitarre zu sechs Saiten" (an Schiller, 17.02.1797). Der Bau der Gitarre zog sich hin (an Körner, 09.03.1797; an Schiller 10.03.1797). Nach zwei Monaten war das Instrument fertig und wurde versandt (an Körner, 07.04.1797; 21.04.1797; an Schiller 17.04.1797). Nach achtzig Tagen konnte Körner es, wenn auch leicht beschädigt, in Empfang nehmen: "Die Guitarre ist da und hat einen schönen Ton" (an Schiller, 28.04.1797; vgl. an Körner 01.05.1797; 03.06.1797). (Goedeke, Karl (Hg.): Schillers Briefwechsel mit Körner. Von 1784 bis zum Tode Schillers. 2. Aufl. Leipzig: Veit & Comp., 1878)
Aus der Korrespondenz geht hervor, dass Otto seine erste sechssaitige Gitarre 1796 für Johann Gottlieb Neumann baute. Dass er nicht der erste Gitarrenbauer war, der eine sechssaitige Gitarre baute, beweisen ältere Gitarrenmodelle aus Neapel. Möglicherweise hatte Naumann in Dresden eine italienische Gitarre mit sechs Saiten gesehen oder von ihr gehört und den Bau einer solchen bei Otto in Auftrag gegeben. Fest steht jedenfalls, dass die sechssaitige Gitarre 1796 nach Deutschland kam und innerhalb weniger Jahre zum Modeinstrument avancierte. Dass die Gitarre überhaupt zum Modeinstrument werden konnte, lag - wie Ottos Bericht bestätigt - daran, dass sie in den besseren Kreisen des Bürgertums und des Adels gespielt wurde. Nicht zufällig gehörte Christina Gräfin von Brühl (1756-1816) zu Ottos Kundinnen.
Der Wiener Beamte und Gitarrenliebhaber Simon Molitor (1766-1848) beschäftigte sich ebenfalls mit dem Ursprung der sechssaitigen Gitarre. Er kam zu dem Schluss, dass die Gitarre gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Italien die sechste Saite erhielt und nach dem Vorbild der Mandora gestimmt wurde. In seinem Vorwort zur „Große[n] Sonate für die Guitare allein“ (1806) schrieb er: „Die Guitare, die itzt bei uns in Aufnahm gekommen, ist ursprünglich die spanische, und nur aus Spanien --- wo sie von jeher beliebt und im Gange war --- nach Italien und Frankreich übersiedelt worden, in welchen Ländern man sie auch noch unter der Benennung der spanischen Guitare kennt. Bei uns ist sie mehr unter der Benennung der französischen Guitare bekannt, eine Benennung, die ihr vermuthlich die Franzosen selbst beigelegt haben, vielleicht um sie von der eigentlichen spanischen, welche noch die doppelte Besaitung hatte, zu unterscheiden. Aus der ältesten spanischen Guitaremusik nimmt man nur die vier Saiten e, h, g, d, wahr, in der neueren ist aber auch schon die fünfte angebracht. In Italien kannte man sie noch vor 9 Jahren meist nur noch in diesem Zustande; wiewohl die ltaliäner die ersten gewesen seyn mögen, die ihr (nach der Aehnlichkeit der in diesem Lande niemals ganz abgeschafften Mandora) noch die sechste Saite, nemlich das tiefe E beifügten. In Frankreich ist --- nach den Komposizionen der beliebtesten französischen Kompositeurs für dieses Instrument zu urtheilen --- diese sechste Saite noch lange nicht so allgemein angenommen, als sie es sollte; bei uns in Teutschland hingegen ist die Guitare itzt nur in diesem vervollkommneten Zustande im Gebrauch. Die Liebhaberei für dieses Instrument hat sich seit einigen Jahren ausserordentlich verbreitet, und scheint, nach der mit jedem Monate erscheinenden Fluth neuer Komposizionen, selbst noch im Zunehmen zu seyn“ (Molitor 1806, S. 9f.; vgl. Staehlin 1811, S. 3; Blum 1818, S. 5; Lehmann 1820, S. 5).
Aus Molitors Text geht hervor, dass die sechssaitige Gitarre in der Zeit um 1806 nur in Italien, Deutschland und Österreich verbreitet war, während in Frankreich die fünfsaitige und in Spanien die fünf- oder sechschörige Gitarre in Gebrauch war. Dies wird durch die Gitarrenschulen bestätigt, die in dieser Zeit veröffentlicht wurden: Die Gitarrenschulen von Antonio Abreu (Salamanca 1799), Fernando Ferandiere (Madrid 1799) und Federico Moretti (Madrid 1799) sowie das Manuskript von Juan Manuel Garcia Rubio (Madrid 1799) sind für die fünf- und die sechschörige Gitarre geschrieben. Die Schulen von Barthélemy Trille La Barre (Paris 1797) und Antoine Marcel Lemoine (Paris 1803) waren für die fünfchörige bzw. die fünfsaitige Gitarre bestimmt, die Schule von Jean-Baptiste Phillis (Paris 1799) für die sechssaitige Gitarre und die Lyragitarre, die Schule von Charles Doisy (Paris 1801) für die fünf- und sechssaitige Gitarre sowie für die Lyra. Leopold Neuhausers kleine Spielanleitung "Le fondament avec plusieurs pièces pour la guitarre seul" (Wien 1801) war ebenfalls für die fünf- und sechssaitige Gitarre gedacht. Die erste Gitarrenschule, die ausschließlich für die sechssaitige Gitarre geschrieben war, erschien 1802 in Halle an der Saale. Ihr Verfasser Heinrich Christian Bergmann wies auf die Neuartigkeit des Instruments hin: "Unsere Guitarre weicht von der französischen dadurch ab, daß sie sechs, jene aber nur fünf Saiten hat" (Bergmann 1802, S. 4).
2 Die sechssaitige Gitarre als Modeinstrument der Damen

Die sechssaitige Gitarre wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts schnell zu einem Modeinstrument. Laien und dilettierende Musiker benutzten die Gitarre als Begleitinstrument zum Gesang oder als Melodieinstrument. Vor allem bei den Damen fand das Instrument großen Anklang. So lobte der Rezensent einer Sammlung von "Arien und Romanzen aus den beliebtesten Opern unserer Zeit" (1799), dass diese für das neue Modeinstrument Gitarre eingerichtet seien: „Für die Guitarre eingerichtet - das ist das Verdienstlichste an dieser Sammlung. Es wird so wenig für dies weiche und anmuthige aber freylich nur eingeschränkte Instrument geschrieben, das immer mehr Liebhaber, insonderheit unter dem andern Geschlecht bekommt, dass man jeden Beytrag dafür mit Dank annehmen muss.“ (AMZ 1/1799, Sp. 654f).
Man kann durchaus sagen, dass die Gitarre in der Zeit um 1800 ein Fraueninstrument war, nicht nur, weil sie bei den Frauen besonders beliebt war, sondern auch, weil sie neben der Harfe und dem Klavier das einzige Instrument war, das Frauen spielen durften. Andere Instrumente galten nach damaliger Auffassung für Frauen als "unschicklich". Warum nur die drei genannten Instrumente für Frauen als "schicklich" galten, erklärt der Rezensent einer Harfensonate von Charles Belleval: „Es wird so wenig, und viel weniger noch Gutes für dies Instrument geschrieben, das allerdings seine Unvollkommenheiten, unterdess doch auch viel Anmuthiges hat, und neben dem Klavier und der Guitarre recht eigentlich das Lieblingsinstrument der Frauenzimmer seyn sollte, weil es das Sanfte, Liebliche enthält, was man bey ihnen selber voraussetzt und schöne Arme und Hände gehörig ins Licht setzt“ (AMZ 1/1799, Sp. 283). Harfe, Gitarre und Klavier waren die Instrumente, deren Klang dem "anmutigen", "sanften" und "lieblichen" Charakter des weiblichen Geschlechts entsprach. Sie erlaubten den Frauen, eine Spielhaltung einzunehmen, die dem bürgerlichen Anstand entsprach. Außerdem wirkten sie sich positiv auf die Anmut der Spielerinnen aus, da sie "schöne Arme und Hände gehörig ins Licht" setzten.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde den Frauen im Bereich der Musik eine spezifische Rolle zugewiesen. Sie hatten die Aufgabe, bei gesellschaftlichen Anlässen kleine Lieder oder gefällige Instrumentalstücke vorzutragen, die Gäste zu unterhalten und durch ihre anmutige Erscheinung zu bezaubern. Diesem Zweck diente bereits die musikalische Erziehung der Mädchen, wie der Bad Schandauer Schulrektor Friedrich Guthmann (1779-1870) in seinem Aufsatz “Winke über den musikalischen Unterricht der Frauenzimmer“ (1806) ausführte: „Derjenige geht ganz falsch, welcher beym Mädchen, z. B. das Klavierspiel, nach dem, für den Virtuosen nothwendigen, hier aber zu gründlichen, zu ermüdenden, zu weitläuftigen Wege der Kunst erlernen Iässt. Die Früchte sind zwar gewiss, aber für die kurze Zeit des Unterrichts zu sparsam und zu spät. Die Schülerin ermüdet auf halben Wege. Der weibliche Sinn will mehr Blumen und frühe Frühlings-Früchte“ (AMZ 8/1806, Sp. 514). „Kleine liebliche, naive Lieder, Tänze, Rondos, leichte Sonaten, Variationen - sind hier am passendsten zum Zwecke.“ „Mir kommt es überhaupt bisweilen vor, als wenn gerade diese kleinen Sächelchen den grössten Theil unserer Mädchen mehr zierten, als wenn sie ihre Kräfte zu hohem Fluge versuchen. Es blickt dort mehr die beschränkte, aber liebliche Weiblichkeit hervor“ (Sp. 515). „Was ich hier vom Klavierspiel sagte, das gilt auch von der Erlernung des Singens, der Guitarre, der Harfe etc.“ (Sp. 514). Das professionelle, öffentliche Musizieren war eine Domäne der Männer, den Frauen wurde nur das dilettantische Musizieren im häuslichen Rahmen zugestanden.
Der Damenwelt wurde die Gitarre als "ein neuer Modeartikel" vorgestellt. 1801 schwärmte das "Journal des Luxus und der Moden" von den Vorzügen des "niedlichen" Instruments: "Die Guitarre, seitdem sie bei unsern Schönen durch ihren bezaubernden Ton, durch ihre niedliche Form, durch den Reiz, den ihre Handhabung der Spielerin giebt, durch ihre weder beim Sitzen noch beim Stehen oder Gehen je lästige Gesellschaft und durch die Leichtigkeit mit ihr vertraut zu werden, sich einzuschmeicheln gewußt hat - verdient gewiß unter den beliebtesten Modeartikeln eine vorzügliche Stelle. Welche Verehrerin der Musik sollte in ihrem Zimmer diesem Instrumente einen Platz versagen, das im Dienste der Musen und Grazien steht, das mit beiden den vertrautesten Umgang verräth und mit seinem nach der Mode gefärbten Trageband niedlich umschlungen, von schöner und bezaubernder Kunst gewis das sprechendste Bild ist?" (Journal des Luxus und der Moden 16/1801, S. 623f.).
Wesentlich nüchterner beurteilte die Schriftstellerin und Musikpädagogin Nina d’Aubigny von Engelbrunner (1770-1847) den Wert des Modeinstruments. In ihren „Briefen an Natalie über den Gesang“ (1803) schrieb sie: „Hier scheint es mir am gelegenen Ort, noch von einer Art von Begleitung des Gesangs zu reden, die jetzt ein Werkzeug der Mode geworden, und freilich eine angenehme Gefährtin und Beförderin des geselligen Vergnügens werden könnte, wenn sie in gute Hände fällt. - Sie errathen, daß von der Chitarre die Rede ist, die seit einiger Zeit ein Modemeuble wurde, und wahrscheinlich bei denen, die das liebliche Spielwesen als solches behandelten, auch wieder eben so schnell verstummen dürfte, als es jetzt erklingt. Die geringe Schwierigkeit, die Arpeggiaturen aus den leichtesten Tönen selbst einem Schüler von wenig Talenten beizubringen, veranlaßt allgemein den Wunsch, ein so graziöses als leichtes Instrument zu spielen. (…) Wenn auch einige Virtuosen es versucht haben, Sonaten und Koncerte auf der Chitarre zu spielen, so wird doch der richtige Beurtheiler dieses Instruments immer einräumen müssen, daß dies gegen seine Natur sei, und ihr Gebiet sich auf Begleitung einschränke. (…) Die Chitarre ist eine liebliche Auszierung für den gebildeten Sänger, und er, der von Grund aus musikalisch ist, lernt sie äußerst leicht. Ihr melodischer Ton ründet sich um seine reine Stimme, und er freut sich, ein so wenig Raum erforderndes Begleitungsinstrument in seinem Zimmer, auf ländlichen Parthien, oder im geselligen Zirkel bei sich zu haben, wo es so gefällig einen Mittelpunkt zur Vereinigung zu gewinnen weiß, und man sich so wohl befindet, wenn andere Beschäftigung nicht unterhält. Dann lobt die Gesellschaft das befreundende Instrument. Allein die Chitarre erndtet da meist ein Lob, das eigentlich dem Sänger zukommt“ (d’Aubigny 1803, S. 225f).

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass ein Großteil der Gitarrenliteratur für Frauen geschrieben wurde. So wandte sich Joseph Küffner (1776-1856) in seinem "Vorbericht" zu seinen "Soixante Leçons pour deux Guitares" (Op. 168) ausdrücklich an das weibliche Geschlecht: "Wie sehr die Tonkunst zur Erheiterung und Beglückung des Lebens beitrage, dies wird mit jedem Tage mehr erkannt. Daher die sich immer mehrende Anzahl ihrer Verehrer, besonders aus dem Geschlechte, dessen schöne Bestimmung es ist, des Lebens Pfade mit Blumen zu bestreuen. Daher auch die allgemeine Liebe zur Guitarre, diesem lieblichen Instrumente, so ganz geeignet gesellige Freude anzuregen und zu erheben". Und Ferdinando Carulli (1770-1841) richtete seine überarbeitete Gitarrenschule explizit an das "schöne Geschlecht": "Möge sie vor allem bei dem liebenswürdigen Geschlecht Anklang finden, dessen Lieblingsinstrument die Gitarre zu sein scheint, wegen der Anmut, die sie seiner Haltung verleiht, und dessen rührende Stimme ihren Akkorden so viel Charme hinzufügt" (Carulli 1830, S. II übers.).
Die spieltechnischen Anforderungen wurden für dilettierende Musikerinnen zunächst sehr niedrig gehalten. Mit Blick auf die Zielgruppe wurden einfache Gitarrenstücke und Liedbegleitungen veröffentlicht. Die Kritik nahm die anspruchslosen Gitarrenveröffentlichungen wohlwollend auf. So lobte der anonyme Rezensent der von Johann Conrad Schlick herausgegebenen Sammlung "Recueil de petites Pièces pour Ia Guitarre" (1801): "Bey der fast durch ganz Deutschland, und durch einen Theil ltaliens und Frankreichs von neuem verbreiteten lebhaften Liebhaberey an der zwar eingeschränkten, doch anmuthigen, dabey leichten, und (was gewiss zu jener Verbreitung nicht wenig beygetragen hat) den Dilettantinnen so sehr wohl lassenden Guitarre, war es recht gut, dass ein Mann, von Kenntnis und Geschmack, wie der als Komponist und Virtuos auf dem Violoncell bekannte Herr SchIick in Gotha, ein solches kleines Magazin von Artigkeiten für dies Instrument anzulegen begann“ (AMZ 3/1801, Sp. 717). Die wohlwollende Haltung gegenüber seichter Gitarrenmusik fand jedoch schnell ein Ende, wenn es um den eigentlichen Wert der Musik ging. So stellte der Moskauer Korrespondent der "Allgemeinen musikalischen Zeitung" Kesler klar, dass "die seichte Guitarre ... nur ein musikalischer Schmetterling ist, dessen ganze Schönheit in einem bischen Flügelstaub bestehet“ (AMZ 3/1801, Sp. 687).
Keslers Urteil wird verständlich, wenn man die Gitarrenschulen betrachtet, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts veröffentlicht wurden. Ihr Hauptzweck bestand darin, Anfängern die Grundlagen der Akkordbegleitung zu vermitteln. Zwar wurden auch Tonleitern und gelegentlich Verzierungen für das Melodiespiel vorgestellt, der didaktische Schwerpunkt lag jedoch auf dem Akkordspiel. Die anonym erschienene "Guitarre-Schule" (1802) hob die Bedeutung der Akkordbegleitung hervor: "Dieses Kapitel [= Von den Accorden] ist so wichtig, dass derjenige, der bei Erlernung der Guitarre es nicht sorgfältig benutzt, gewiss den Zweck seiner Bemühungen verfehlen wird" (N. N. 1802, S. 11). Entsprechend schloss sie mit dem Kapitel "Vom Accompagnement". Die Zielgruppe der "Guitarre-Schule" waren Amateursängerinnen, wie eine Werbeanzeige des Verlegers in der "Zeitung für die elegante Welt" belegt: "Da dies romantische Instrument immer mehr Mode wird und auch wirklich jede Dame, welche singt, dabei sehr reizend erscheinen kann, so ist es unnöthig zu sagen, welch ein großer Dienst dem Publikum durch ein solches Werk erzeigt wird" (ZEW 2/1802, Sp. 352). An die gleiche Zielgruppe richteten sich auch die Gitarrenschulen von J. F. Scheidler und Johann Heinrich Carl Bornhardt, die Anhänge mit Liedern zur Gitarre enthielten. Selbst Doisys "Vollständige Anweisung für die Guitarre" (1802) wurde unter dem Aspekt ihrer Eignung zur Liedbegleitung beworben: "Eine neue Anweisung zur Guitarre von Doisy, der Mad. Bonaparte gewidmet, übertrifft auch die bisherigen sämmtlich - vornehmlich darin, dass der Verf. so gute Anweisung giebt zur freyen Begleitung des Gesanges, was ja doch hier die Hauptsache ist" (AMZ 5/1803, Sp. 864f.).
3 Die Biedermeiergitarre als populäres Begleit- und Soloinstrument
War die Gitarre um 1800 eher ein modisches Accessoire für Damen, so wuchs in den folgenden Jahren das allgemeine Interesse an dem neuen Instrument. Die Zahl der Gitarrenveröffentlichungen nahm stark zu. Neben Liedern und einfachen Gitarrenstücken wurden auch Ensemble- und Solowerke für Gitarre veröffentlicht. Die Besprechungen von Gitarrenwerken in der Fachpresse richteten sich gleichermaßen an weibliche und männliche Spieler. Die "Allgemeine musikalische Zeitung" beispielsweise richtete ihre Artikel zunächst an "Liebhaber der Guitarre" (AMZ 5/1803, Sp. 59) und an "Liebhaber und Liebhaberinnen der Guitarre" (AMZ 8/1806, Sp. 284), später an "geübte Spieler" (AMZ 10/1808, Sp. 350; AMZ 11/1809, Sp. 191; AMZ 11/1809, Sp. 191; AMZ 13/1811, Sp. 528), "Guitarrenspieler, die über die Elemente hinaus sind" (AMZ 14/1812, Sp. 710) sowie an "Freundinnen und Freunden des Solospiels auf der Guitarre" (AMZ 15 (1813), Sp. 290f.). Offensichtlich vollzog sich im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ein Wandel im Ansehen und Gebrauch der Gitarre: Sie wurde nicht mehr nur zur einfachen Liedbegleitung eingesetzt, sondern auch als Ensemble- und Soloinstrument zur Darbietung anspruchsvollerer Stücke. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig:
1) Im Zuge der Verbürgerlichung der Musik zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstand eine vielfältige Musiklandschaft, die neben dem öffentlichen Konzertwesen und der Salonkultur, auch die Haus- und Privatmusik umfasste. Die Hausmusik war zu Beginn des 19. Jahrhunderts fester Bestandteil der bürgerlichen Geselligkeit. Musik war für viele auch zu einem Mittel der Selbstverwirklichung geworden. So stellte der Komponist Karl Bernhard Wessely (1768-1826) in seinen kritischen Bemerkungen "Ueber Musikliebhaberey" fest: "In unserm lieben deutschen Vaterlande will und muss ein jeder musikalisch seyn. Wer nur irgend von gutem Tone ist, spielt ein Instrument, oder beschäftigt sich wohl gar mit Komposition" (AMZ 2/1800, Sp. 528). Die Gitarre galt als ideales Einstiegsinstrument, das leicht zu erlernen und zudem preiswert war (AMZ 8/1806, Sp. 363). Sie diente als Ersatz für das beliebte, aber teure Klavier. So klagte der Verfasser des Artikels "Uebersicht des Zustandes der Musik in Königsberg": "Wo man aber, was selten ist, im ganzen Hause kein Klav. Instr. findet, da hängt doch sicher eine Guitarre. Statt dass dieses Instrument nur dem ausgebildeten Sänger dienen sollte, fängt jetzt fast alles das Musikstudium mit der Guitarre an. Je nun, es ist auch darnach!" (AMZ 11/1809, Sp. 620f.). Und E. T. A. Hoffmann (1776-1822) jubelte in seinem Aufsatz "Des Kapellmeisters, Johannes Kreislers, Dissertatiuncula über den hohen Werth der Musik": "Es ist nicht zu leugnen, dass in neuerer Zeit, dem Himmel sey's gedankt! der Geschmack an der Musik sich immer mehr verbreitet, so dass es jetzt gewissermassen zur guten Erziehung gehört, die Kinder auch Musik lehren zu lassen, weshalb man denn in jedem Hause, das nur irgend etwas bedeuten will, ein Klavier, wenigstens eine Guitarre findet" (AMZ 14/1812, Sp. 503).
2) Ein zweiter Grund für die wachsende Beliebtheit der Gitarre war ihre Transportfähigkeit. Simon Molitor hob diesen Vorzug der Gitarre hervor: "Gewiss hat aber die Guitare manche Vorzüge, welche sie mit Recht zu einem Lieblingsinstrumente unsrer Zeit gemacht haben. Der geringe körperliche Umfang, und die Leichtigkeit derselben machen sie zu dem bequemsten und tragbarsten unter allen Instrumenten, welche der Harmonie gewidmet sind, und als solche zur Begleitung des Gesangs oder zur Aufführung ganzer Tonstücke gebraucht werden. Mit dem Klavier oder mit der Harfe sind wir fast immer zwischen unsre vier Wände gebannt; die Guitare hingegen ist eine angenehme Begleiterinn auf einsamen Spaziergängen, wenn unser Herz von wunderbaren Gefühlen überströmt, und diese in Töne und Gesang auszudrücken sich gedrungen fühlt; oder in Gesellschaft, wenn die Schönheiten der Natur das Herz für Freude und Gesang geöffnet haben. Wer vermöchte diese Gefühle des Augenblicks immer bis zur Zurückkunft zum Klavier oder zur Harfe festzuhalten" (Molitor 1806, S. 11; vgl. Staehlin 1811, S. 3; Bathioli 1825 Theil I/1, S. 10; Noriéga 1833, S. 3).
Die Gitarre konnte überall mit hingenommen werden: in den Garten, auf Spaziergänge, zu Landpartien, Nachtmusiken, Serenaden oder Festen. Das Musizieren im Freien ermöglichte ein intensiveres Naturerlebnis und förderte Geselligkeit und Frohsinn. Diese Vorzüge der Gitarre wurden vor allem von männlichen Gitarristen geschätzt. Ein anonymer Autor, der im Jahre 1804 über das Musikleben in Hannover schrieb, ging sogar so weit zu behaupten, die Gitarre sei eher für das männliche als für das weibliche Geschlecht geeignet: „Die Guitarre ist in Hannover ein sehr beliebtes Instrument. Wegen des Druckes, den die Finger erleiden, und seiner vorzüglichen Anwendbarkeit bey Nachtmusiken, scheint es sich noch mehr für das männliche, als für das weibliche Geschlecht zu eignen. Eine Guitarre mit Begleitung einer Flöte ist sehr angenehm in Ermangelung des Gesanges, oder zur Begleitung beym Tanz“ (AMZ 6/1804, Sp. 360f.).
Wie das Gitarrenspiel in geselliger Runde aussehen konnte, beschreibt anschaulich ein Bericht über das erste deutsche Musikfest in Frankenhausen, bei dem der Thüringer Komponist Albert Gottlieb Methfessel (1785-1869) zur Gitarre sang: „Hr. Methfessel ergriff die Guitarre und unterhielt die Gesellschaft mit angenehmen Liedern und rührenden Romanzen, von seiner Composition; zur Abwechselung gab er auch ein Paar komische Lieder, und entwickelte in diesen seine lebhafte Phantasie, seinen Reichthum an Erfindung, Witz und Laune im Ausdrucke, so wie überhaupt seine Bekanntschaft im Reiche der Töne und der Harmonie. lhm nahm dann der Hr. Berg-Assessor Hachmeister aus Clausthal, die Guitarre ab, und ergötzte die Gesellschaft mit Volksliedern im thüringischen Dialect, voller Witz und Laune, welche den Zuhörer zwangen, die Leiden der Zeit zu belachen, er mochte wollen oder nicht“ (AMZ 12/1810, Sp. 758).
3) Simon Molitor nannte noch einen weiteren Grund für die Beliebtheit der Gitarre, nämlich ihre Fähigkeit, feinste Gefühlsnuancen auszudrücken: "In Hinsicht auf Ton wird niemand bestreiten, dass der Ton der Guitare sich besonders vortheilhaft an die menschliche Stimme anschmiegt, und dass die manchfaltigen Modulazionen, deren derselbe fähig ist, dieses Instrument in die Reihe derjenigen setzen, welche vorzüglich geeignet sind, Leidenschaften zu erregen und Leidenschaften zu beschwichtigen, mithin den Zweck der Musik unmittelbar zu erfüllen" (Molitor 1806, S. 11f.). Im Gegensatz zum Klavier, bei dem die Saiten mit einem Hammermechanismus angeschlagen wurden, wurden die Saiten der Gitarre mit den Fingern gezupft. Der Gitarrist hatte direkten Kontakt zu den Saiten und konnte den Klang des Instruments unmittelbar beeinflussen. Die Saiten reagierten sensibel auf kleinste Nuancen des Anschlags. Nicht zuletzt deshalb schätzten Dichter, Sänger und Komponisten der Frühromantik die Gitarre als Instrument.
Die sanft klingende Gitarre eignete sich besonders zur Liedbegleitung, da sie den lyrischen Vortrag des Sängers in den Vordergrund rückte. Der anonyme Verfasser des Artikels "Die Guitarre" (1808), vermutlich Gottfried Weber (1779-1839), konnte daher gar nicht genug Lob für die Gitarre aussprechen: "Das Lied ist wieder Hauptsache geworden, der Vortrag des Sängers hat seine geniale Freiheit wieder erhalten, das lebendige Gefühl des Herzens wird nicht mehr durch Künstelei schwieriger Tonfülle erdrückt. (...) Die gewöhnliche Manier des Gesangs, die nur den Ton berücksichtigt, und auf das Portamento und die Verzierungen einen Hauptwerth legt, paßt zu keinem Instrument weniger als zur Guitarre: durch sie haben besonders unsre Sängerinnen das deutliche Aussprechen der Worte fast ganz verlernt, und mit ihm jeden Ausdruck der Deklamazion. Zur Guitarre muß mehr melodisch gesprochen als gesungen werden, und alles kommt auf den schönen und ausdrucksvollen Vortrag an. (...) Möge die Mode, die dieses schöne Instrument in unsre gesellschaftlichen Kreise eingeführt hat, auch seinen Gebrauch immer mehr vervollkommnen!" (ZEW 8/1808, Sp. 1166f.; vgl. ZEW 12/1812, Sp. 239).
Das Repertoire an Liedern mit Gitarrenbegleitung, das zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstand, wäre sicherlich eine eingehendere Untersuchung wert. Zu den bekanntesten Komponisten, die in dieser frühen Phase im deutschsprachigen Raum Lieder mit Gitarrenbegleitung veröffentlichten, gehören Johann Heinrich Carl Bornhardt, August Harder, Leonhard von Call und Bartolomeo Bortolazzi.
4 Die Gitarre als konzertierendes Begleitinstrument bis 1806
Obwohl die Gitarre um 1800 ein beliebtes Modeinstrument war, spielte sie im öffentlichen Konzertleben nur eine untergeordnete Rolle. Wenn sie im Konzert eingesetzt wurde, dann meist als Begleitinstrument. So sang am 22. März 1802 ein gewisser Aimari im Berliner Hotel "Stadt Paris" Lieder und Arien zur Gitarre: „Den 22sten gab ein soi-disant 'berühmter Guitarrenspieler' Prof. Aimari ein Konzert in der Stadt Paris, wo er sich mit Bravourarien und italienischen und französischen Arietten von seiner Komposition in Begleitung der Guitarre hören liess“ (AMZ 4/1802, Sp. 478f.). Der Tenor Wilhelm Ehlers (1744-1845) trat in mehreren Berliner Privatgesellschaften mit Gitarre auf und gab am 18. Juli 1805 ein Konzert in Berlin: „Er sang eine Scene von Paer, und mehrere von ihm gesetzte Gesänge mit Begleitung der Guitarre, die er selbst sehr brav spielte“ (AMZ 7/1805, Sp. 716; vgl. ZEW 5/1805, Sp. 592.752). Am Ostersonntag 1806 begleitete der Liederkomponist Ludwig Berger (1774-1828) in einem Konzert der Gebrüder Hoffmann in Frankfurt am Main seinen Gesang mit der Gitarre: „Zum Schluss sang Hr. Berger einige Lieder blos mit der Guitarre begleitet; er sang und spielte gut. So vortheilhaft es mir nun aber für den Zuhörer und den Künstler scheint, und so oft ich schon gewünscht habe, dass auch in öffentlichen Konzerten, wie bey Privatgesellschaften der Liebhaber, die immer wiederkehrenden Bravourarien mit schönen Liedern zuweilen möchten vertauscht werden: so wenig kann ich es rühmen, wenn man solche Guitarren-Liedchen öffentlich singt. Abgesehen vom Text, wo man in jeder Strophe das Liebchen findet, so muss schon die Musik in der Begleitung für eine öffentliche Versammlung zu dürftig und mager ausfallen, und überdies wird hierdurch das ohnehin jezt schon über Verdienst accreditirte und für die weitere Ausbildung und den solidern Geschmack in der Kunst sehr nachtheilige Instrument noch zu immer höhern, unverdienten Ehren gebracht. Auch ist es dem Zweck und den Eigenthümlichkeiten dieses Instruments selbst geradezu entgegen, in grossen, öffentlichen Versammlungen produzirt zu werden - höchstens den Fall ausgenommen, dass dies von einem ganz ausgezeichneten Virtuosen geschieht. Es gehört ins kleinere Zimmer, ans Kamin oder den Theetisch, in den kleinern Zirkel guter Freunde, und, wenn man‘s nicht lassen kann, zur stillen Nachtzeit unter das Fenster der Geliebten“ (AMZ 8/1806, Sp. 485f.).

Die Lieder, die in öffentlichen Konzerten mit Gitarrenbegleitung vorgetragen wurden, fanden bei der Kritik eher selten Anklang. Die Duos für Mandoline und Gitarre, die Bartolomeo Bortolazzi zusammen mit seinem Sohn auf einer Deutschlandtournee spielte, wurden hingegen positiv aufgenommen. Bartolomeo spielte die Mandoline, sein Sohn Biagio Domenico, laut Bortolazzi sieben Jahre alt, übernahm den Gitarrenpart. Die Tournee begann 1803 in Wien und führte Bortolazzi nach Dresden, Leipzig, Braunschweig, Berlin und wieder zurück nach Leipzig und Wien.
Bortolazzis Konzerte in Deutschland wurden in der Fachpresse ausführlich besprochen. Exemplarisch sei hier der Bericht über das Konzert zitiert, das Bortolazzi während der Leipziger Michaelismesse Ende September 1803 gab: "Herr BortoIazzi, Virtuos auf der Mandoline. Auf der Mandoline? wiederholen viele Leser kopfschüttelnd und lächelnd. Es sey drum! Wahr ist es allerdings, dass dies kleine, beschränkte, in weniger geschickter Hand nur zirpende Instrument nicht ohne Grund wenig Kredit in Deutschland hat: aber Hr. B. giebt den vollgültigen Beweis, wie Geist, Gefühl, Geschmack und unermüdlicher Fleiss auch durch ein unbedeutendes Organ zu sprechen vermögen. Seine Konzerte mit voller Orchesterbegleitung können, der Natur der Sache nach, weniger interessiren: aber seine Variationen und ähnliche kleinere Stücke, (meistens von seinem siebenjährigen Sohne auf der Guitarre, und gut begleitet,) so wie sein Improvisiren, sind sehr hörenswerth und äusserst erfreulich. Schwerlich möchte irgend Jemand, als ein Italiener, durch Kleines so interessant werden können. Hr. B. hat auch artige Kompositionen für sein Instrument herausgegeben; andere werden bald erscheinen" (AMZ 6/1804, Sp. 45f.).
Bortolazzi war der erste Berufsmusiker, der die Mandoline und die Gitarre als konzertierende Instrumente erfolgreich auf die Bühne brachte. Die seltene, aber klanglich reizvolle Kombination der Zupfinstrumente kam beim Publikum offensichtlich gut an. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass die Gitarre hier nur als Begleitinstrument und nicht als gleichberechtigter Duopartner eingesetzt wurde. Auch die Tatsache, dass ein "Siebenjähriger" die Gitarre spielte, trug sicher nicht zum Ansehen des Instruments bei.
Unter den vielen dilettierenden Gitarristen gab es auch versierte Spieler, die in kleineren Konzerten ihr Können unter Beweis stellten. So trat die Frankfurter Bankierstochter Marie Gontard (1788-1883) am 1. März 1805 als Mitglied eines Kammermusikensembles auf: „Am 1sten März gab Hr. Baumgärtner, Klarinettist bey dem hiesigen Theaterorchester, ein Konzert. Auf eine Sinfonie aus D dur von Mozart folgte ein Terzett - ein sehr mittelmäßiges Fabrikat - für Guitarre, Violin und Violoncell. Die Guitarre wurde von Dem. Gontard, einer jungen Liebhaberin, sehr artig gespielt“ (AMZ 7/1805, Sp. 549). Der Organisator des Konzerts, der aus Wien stammende Klarinettist Joseph Baumgärtner, war Gontards Gitarrenlehrer (Belli-Gontard, Maria: Lebens-Erinnerungen. Frankfurt am Main: Joh. Chr. Hermann, 1872. S. 63f.).
5 Die Gitarre als solistisches Konzertinstrument bis 1806
Als solistisches Konzertinstrument wurde die sechssaitige Gitarre zu Beginn des Jahrhunderts kaum verwendet. Der französische Gitarrist Antoine de Lhoyer (1768-1852), der am 4. Dezember 1802 in Berlin konzertierte, spielte noch auf der in Frankreich üblichen fünfsaitigen Gitarre: "Das erste [Konzert] gaben am 4ten die Hrn. Isidor St. Leon, aus der russis. Kapelle, und L' Hoyé, Mitglied der ehemaligen französischen Schauspielergesellschaft des verstorbenen Prinzen Heinrich in Rheinsberg. Im ersten Theile zeichneten sich aus: die Scene und Arie von Nicolini, von St. Leon gesungen; Capriccio und Variationen auf der Guitarre von L' Hoyé; und ein Duett aus der bekannten franz. Operette: La maison à vendre ... gesungen von Calais und St Leon" (AMZ 5/1803, Sp. 309f.).
Auch der französische Gitarrist d‘ Aymard, der am 1. Oktober 1804 in Braunschweig konzertierte, spielte auf einer fünfsaitigen Gitarre: „Den 1. Oct. gab Hr. d' Aymard, Professeur de Guitarre et Vocale allhier, ein Konzert, in dem er sich in beyden Künsten bewundern liess. Unpartheyische sollen über seine Fertigkeit gewaltig den Kopf geschüttelt haben - zum Staunen hatte freylich jeder Gelegenheit. Uebrigens bemerke ich nur, dass Hr. d‘ A. hier die Guitarre mit 6 Saiten auf 5 reducirte, und in seinem Prospectus der Apologie de Guitarre sich wundert, wie die deutschen Komponisten so auf den Kopf gefallen wären, dass sie auf die Titel ihrer Werke setzen können, 'mit Begleitung des Klaviers oder der Guitarre,' da doch beyde lnstrumente so himmelweit unterschieden wären. Hr. d' A. hatte jedoch nur die Titel angesehen“ (AMZ 7/1805, Sp. 210f.).
Das erste Solokonzert für die sechssaitige Gitarre fand wahrscheinlich in Wien statt. Im Dezember 1804 trat der Gitarrist Alois Wolf (1775-1819) gemeinsam mit seiner Frau Anna, geborene Mrasek, im Jahnsaal auf: „Ein Hr. Wolf gab ein Konzert im Jahnischen Saale. Er spielte ein Konzert auf der Guitarre mit ungemeiner Leichtigkeit, Geschwindigkeit, und einem recht angenehmen Vortrage; überhaupt weiss er sein Instrument recht gut zu behandeln. Seine Frau trug ein Mozartsches Klavierkonzert aus D moll mit Fleiss und Geschicklichkeit vor“ (AMZ 7/1805, Sp. 242). Bäuerles Theaterzeitung hob in ihrer Ausgabe vom 10. Oktober 1807 hervor, dass Wolf seit "mehr als 12 Jahre[n]" als Gitarrist in Wien tätig sei und ihm der "Ruhm" gebühre, "der erste gewesen zu seyn, welcher in einer Hauptstadt wie Wien, ein in Passagen eben so schweres, als stark instrumentirtes Conzert auf der Guitarre produzirte, welches, besonders von Kennern, mit so ausgezeichneter Bewunderung aufgenommen wurde" (BT 15/1807, S. 41). Franz Tandler (1782-1807) war auch einer der ersten, der die sechssaitige Gitarre als Soloinstrument in Wien etablierte. Simon Molitor lobte Tandler als einen "ausgezeichnete[n] Dilettanten", der "die gewöhnliche sechssaitige Guitare nicht bloss mit seltener Fertigkeit, sondern auch nun ganz in jener vollkommenen Manier behandelt, welche allein den Kenner vergnügen, und als Muster der guten Spielart aufgestellt werden kann" (Molitor 1806, S. 10, Anm.).
Die Soloauftritte anderer Gitarristen in Wien waren wohl weniger professionell. Molitor beklagte den Hang der Gitarristen zur Effekthascherei: "Es ist sehr zu bedauern, dass selbst Guitaristen, die es auf ihrem Instrumente zu einer seltenen Fertigkeit gebracht haben, die selbst diesem Instrument einen höhern Rang in der musikalischen Welt zu verschaffen ganz berufen wären, mehr durch zwecklose Künsteleien als durch solides Spiel und angenehmen Vortrag den eitlen Beifall der Menge zu erreichen sich bestreben, ja, dass sie sogar aus Sucht sonderbar zu seyn, auf die sonderbarsten Missbräuche und auf die lächerlichsten Einfälle gerathen. Dahin rechne ich z. B. den allzuhäufigen Gebrauch oder vielmehr Missbrauch des seynsollenden Flageoletts - das Reissen der Saiten mit den Nägeln (wodurch sie den Darmsaiten vermuthlich den Ton von Drahtsaiten geben wollen, und wozu sie sich anstatt der Nägel auf eine künstliche Art eigene Klauen wachsen lassen) dann das Klopfen und Trommeln auf dem Resonanzboden, indem sie nemlich zum Anfange eine Entrata, oder in den Zwischensätzen einen förmlichen Tusch austrommeln u.a.m." (Molitor 1806, S. 10, Anm.).
Auch in Deutschland gab es zaghafte Versuche, die sechssaitige Gitarre als Konzertinstrument zu etablieren. Am 5. Dezember 1804 spielte ein gewisser Herr Koch in Berlin in einem Konzert der Violinistin Marie Susanne Schmidt (1762-?), geb. Janitsch, "einige Variationen auf der Guitarre" (AMZ 7/1805, Sp. 255). Am 16. August 1805 trat er in Wittenberg als Gitarrist und Cellist auf. Die Kritik zeigte sich angetan: "Besonders bewunderten wir ihn in seinen für die Guitarre selbst komponirten Variazionen. Den Beschluß seines Konzerts machte er mit einer von ihm selbst verfertigten und komponierten Romanze, die allgemein gefiel" (ZEW 5/1805, Sp. 752). Ende 1805 gab der Berliner "Maitre de la Guitarre" mehrere Konzerte in Leipzig, unter anderem am 10. Dezember, für die er viel Beifall erhielt (ZEW 5/1805, Sp. 1192; AMZ 8/1806, Sp. 229).
6 Die Forderung nach einer solistisch-konzertanten Behandlung der Gitarre

Die Beliebtheit der Gitarre bei musikalischen Laien trug nicht zu ihrem Ansehen bei. Im Gegenteil: Musikkenner standen dem "beschränkten Instrument" und den für die Gitarre komponierten "Kleinigkeiten" und "Werkchen" skeptisch bis ablehnend gegenüber (AMZ 6/1804, Sp. 316; AMZ 7/1805, Sp. 676; AMZ 8/1806, Sp. 284; AMZ 9/1807, Sp. 258). Entsprechend klagte Simon Molitor in der Vorrede zu seiner „Große[n] Sonate für die Guitare allein“ (1806): "Die Liebhaberei für dieses Instrument hat sich seit einigen Jahren ausserordentlich verbreitet, und scheint, nach der mit jedem Monate erscheinenden Fluth neuer Komposizionen, selbst noch im Zunehmen zu seyn.
Der wahre Kenner und Liebhaber der Musik seufzt darüber, als über einen Beweis der Frivolität unsres Zeitalters, das an einem Instrumente Geschmack findet, welches nur allenfalls zur Begleitung bei Kleinigkeiten in wenigen Tonarten, und auch in diesen nur in den allergewöhnlichsten Accorden, brauchbar sey. Der strengere Kunstliebhaber eifert sogar gegen dieses Instrument, welches, eben durch die Leichtigkeit womit man auf demselben die gewöhnlichsten Accorde in einigen Tonarten hervorbringen lernt, und durch die Unbekümmerniss, womit diese Accorde --- meistens ohne Rücksicht auf ihre Lage und ihr Verhältniss unter sich --- gespielt werden, zur schalesten Klimperei verleite, und dessen Verbreitung daher dem guten Geschmack in der Kunst wahren Nachtheil bringe.
Und leider sind, so wie die Guitare fast durchgängig behandelt wird, jene Vorwürfe nicht ohne Grund. Die meisten Guitare-Komposizionen sind so wenig als das Spiel der meisten Guitaristen dazu geeignet, jene Meinung zu widerlegen: diese Tändeleien, dieses unaufhörliche Arpeggiren regelloser Accorde, diese dem Instrument gar nicht angemessene Künsteleien, welchen selbst die besseren unter den Guitarespielern nachjagen, können dem Musikkenner nur eine schlechte Meinung von diesem Instrumente beibringen. Diese ganz falsche Behandlung der Guitare, und der gänzliche Mangel an Komposizionen, welche mit den Fortschritten aller andern Instrumente nur einigermassen in Verhältniss stünden, werden wahrscheinlich auch den Verfall dieses Instruments nach sich ziehen, so wie aus ähnlichen Ursachen schon die Laute und die Mandor ihre Periode überlebt haben" (Molitor 1806, S. 10f.).
Molitor forderte von den Musikliebhabern eine professionellere Behandlung der Gitarre, eine solidere Art des Spielens und Komponierens, um "diesem Instrument einen höhern Rang in der musikalischen Welt zu verschaffen" (ebd. S. 10 Anm.). Gute Ansätze dazu sah er bei den in Wien lebenden Gitarristen Anton Diabelli (1781-1858) und Wenzel Matiegka (1773-1830) sowie bei dem in Mailand und Wien publizierenden Virtuosen Ferdinando Carulli (1770-1841) (ebd. S. 13, Anm.). Deren Ergebnisse entsprachen jedoch nicht ganz seinen Vorstellungen: "Wie dem auch sey, so ist mir wenigstens noch kein Kompositeur für dieses Instrument bekannt, der einen ausführlichen Versuch geliefert hätte, auf demselben die Harmonie in Grundton und Mittelstimmen im gehörigen Zusammenhang und Verhältniss so durchzuführen, wie man es doch sonst von allen Instrumenten fodert, deren ganzes Wesen vorzüglich in Harmonie besteht" (ebd. S. 13). Aus diesem Grund komponierte Molitor selbst eine „Große Sonate für Guitarre allein“ (1806), die er der musikalischen Öffentlichkeit als "Muster einer solidern Komposizion für die Guitare" vorstellte: "Gegenwärtige grosse Sonate gebe ich nun dem kunstliebenden Publikum als den ersten Versuch, auf der Guitare allein ein ganzes mit beständiger Rücksicht auf die Regeln und Forderungen der Kunst ausgeführtes Tonstück darzustellen" (ebd. S. 13).
Auch Friedrich Guthmann setzte sich für eine stärkere Wahrnehmung der Gitarre als Kunstinstrument ein. In seinem Aufsatz "Ueber Guitarrenspiel" (1806) forderte er die Gitarristen auf, die klanglichen Möglichkeiten des Instruments voll auszuschöpfen: "Die Guitarre ist ein Instrument, welches, gut gespielt, ausserordentlich viel Bezauberndes hat, und weit mehr in sich enthält, als man dem ersten Anscheine nach glauben möchte. Man denkt sich dieses Instrument blos als Begleitung des Gesangs, und es ist wahr, dass es sich dazu vorzüglich eignet, und dabey gute Wirkung thut, selbst wenn es ziemlich mittelmässig gespielt wird. Dies - und seine geschmackvolle, gefällige Form, seine leichte Transportabilität, seine Neuheit, welche durch die Mode unterstützt wird, die Leichtigkeit, etwas Weniges darauf zu erlernen, die Wohlfeilheit des Instruments - dies alles mag ihm den guten Eingang und die Aufnahme verschafft haben, welche es fand. - Soll es aber seine ganze Fülle, seinen ganzen Reichthum zeigen, so ist dazu nicht ummgänglich Gesang nothwendig; es ist zur Phantasie für einen fühlenden Menschen, der aber nothwendig eine hinlängliche Kenntnis der Harmonie überhaupt haben muss, ausserordentlich geschickt, und zeigt gerade hier, ganz eigene Schönheiten. Was für ein liebliches Gewebe von con- und dissonirenden Akkorden, Brechungen, stark und schwach, lässt sich da nicht geben! - Freylich gehört dazu, ausser (wie schon erwähnt) nothwendiger Kenntniss der Harmonie, auch eine längere Übung, Geschmack und Phantasie; dann ist das Guitarrenspiel keine leere Klimperey; sondern wirkliche Kunst" (AMZ 8/1806, Sp. 363).
Am Ende seines Aufsatzes wies Guthmann auf die Notwendigkeit "eine[r] schriftliche[n] Anweisung" hin, "welche dies alles lehren soll" (Sp. 366). Praktischerweise gab er selbst ein Jahr später eine "Anweisung die Guitarre in kurzer Zeit auch ohne Beihülfe eines Lehrers richtig spielen zu lernen" (1807) heraus (IZEW 70/1807, Sp. 6). In der Gitarrenschule führte er den Inhalt seines Aufsatzes weiter aus, beschränkte das Gitarrenspiel aber auf die harmonische Begleitung. Gitarrenfreunde, die mehr von der "schriftliche[n] Anweisung" erwartet hatten, wurden enttäuscht. Guthmanns Lehrwerk bot nicht mehr als andere Gitarrenschulen seiner Zeit.

Guthmanns Sehnsucht nach wahrer Kunst und Molitors Forderung nach einer höheren Art des Spielens und Komponierens erfüllten sich schneller als erwartet. Im Sommer 1806 verließ der Gitarrist Mauro Giuliani (1781-1829) seine italienische Heimat und ging nach Wien. Dort avancierte er rasch zum führenden Gitarrenvirtuosen seiner Zeit. Welchen Eindruck er auf seine Zuhörer machte, beschrieb die "Allgemeine musikalische Zeitung" am 21. Oktober 1807: „Unter den hiesigen, sehr zahlreichen Guitarrespielern macht ein gewisser GiuIiani durch seine Kompositionen für dies Instrument sowol als durch sein Spiel, vieles Glück, ja sogar grosses Aufsehen. Wirklich behandelt er die Guitarre mit einer seltenen Anmuth, Fertigkeit und Kraft“ (AMZ 10/1808, Sp. 89). Giuliani steigerte das Ansehen der Gitarre in Wien beträchtlich. Insofern stellt das Jahr 1806 eine Zäsur in der Geschichte der Gitarrenmusik dar. Von nun an wurden mehr Solowerke für Gitarre veröffentlicht und höhere spieltechnische Anforderungen an die Gitarristen gestellt. Auch wurde die Gitarre zunehmend als Konzertinstrument wahrgenommen. Ähnliche Erfolge sollten Ferdinando Carulli 1808 in Paris und Fernando Sor 1815 in London erzielen.
Der in Idstein bei Frankfurt am Main lebende Johann Jakob Staehlin (1772/73-1839) veröffentlichte 1811 eine Gitarrenschule, deren Titel bereits auf die neue Rolle der Gitarre im zeitgenössischen Musikleben hinwies: "Anleitung zum Guitarrespiel sowohl für diejenigen welche dasselbe blos zur Begleitung anwenden wollen als auch für diejenigen welche die Guitarre als concertirendes und Solo Instrument behandeln zu lernen wünschen" (1811). In der Einleitung griff er wesentliche Punkte der Kritik Molitors auf, konstatierte aber zugleich einen Wandel in der Einstellung zur Gitarre: "Endlich hat man diesen Mangel eingesehen, und fängt seit kurzem an die Guitarre einer bessern Behandlung zu würdigen, eine bessere Orthographie in der Schreibart einzuführen, und durch Compositionen die derselben angemessen und auf den Effect des Instruments berechnet sind, das Guitarrespiel zu dem Grade der Vollkommenheit zu erheben, dessen es fähig ist" (Staehlin 1811, S. 3). Mit seiner Gitarrenschule legte Staehlin eine methodische Grundlage für das "Guitarre-Spiel, welches Melodie und Begleitung verbindet" vor und ging auf die spieltechnischen Voraussetzungen des "höheren" Spiels ein: "Vorzüglich gehört dazu Kraft und Sicherheit bey dem Bedecken|: barré :|, weites Ausreichen mit der linken Hand, völlige Unabhängigkeit der Finger von einander, genaue Bekanntschaft mit der Lage der Töne und Accorde in den oberen Plätzen |: positionen :|, und mit der Lage eines und desselben Tones oder Accordes auf verschiedenen Saiten" (ebd. S. 31). Das "Verfahren bey dem höheren Spiele" erläuterte Stahlin anhand verschiedener Werke bekannter Gitarrenkomponisten - Diabelli, Matiegka, Carulli und Giuliani -, die er mit Fingersatzangaben und spieltechnischen Kommentaren versah (ebd. S. 34).

Ein Jahr später veröffentlichte der Wiener Gitarrist Anton Gräffer (1786-1852) eine zweiteilige "Systematische Guitarre-Schule" (1811-12), in der er unter Bezugnahme auf Molitors Kritik den "Schwall von nichtigen Compositionen" beklagte, der die Kenner und Liebhaber der Musik daran hindere, eine "gerechte Vorliebe für die Guitarre" zu entwickeln. Den Gitarristen, die belanglose Kompositionen auf den Markt brachten, warf er vor, den Sinn der Musik nicht verstanden zu haben. Sie sollten sich vom Ursprungsmythos der Musik leiten lassen und die Botschaft der Orpheussage beherzigen: "Daß es keine tiefere, innigere Wirkung gebe, als die, welche die Tonkunst hervorbringt. Durch ihre sieben einfachen Töne, welche überall verborgen liegen, rühre sie das fühlbare Herz des Menschen, durch sie werde alles, was Leben hat, bewegt und geleitet, durch sie erhalte sich die lebende Welt, denn alle Saiten des sanftesten Gefühls werden durch die orphische Kunst berühret" (Gräffer 1811, S. 6).
Gräffer deutete den Mythos im Geiste der aufkommenden Romantik um: Nicht die menschliche Stimme, sondern die Instrumentalmusik sollte den Sinn und Zweck der Musik erfüllen. Der Gitarre räumte er eine Sonderstellung unter den Instrumenten ein, da sie in besonderer Weise das Herz zu berühren vermag: "Die Musik für die Guitarre wirke größten Theils auf feinere Endzwecke, durch einen einfachen Gesang jener himmlischen Töne - durch liebliche nicht zu verkünstelte Melodieen, welche zu sanften Empfindungen das Gemüth stimmen, und so die Gewalt der Tonkunst als den Magnet der Empfindung bezeugen" (ebd. S. 5). "Die Zartheit ihrer Töne und deren Reichthum werden ihre Dauer begründen" (ebd. S. 3). Mauro Giuliani galt ihm gewissermaßen als Orpheus der Gegenwart. "Giuliani und andere gute Spieler" hätten bewiesen, dass das "Vorurtheil, auf einem Instrumente, welches bloß zur Begleitung des Gesanges geeignet zu seyn scheint", könne man "nicht den Gesang selbst hervorbringen", nicht zutreffe (ebd. S. 6).
1812 arbeitete Simon Molitor seine Vorrede zu seiner „Große[n] Sonate für die Guitare allein“ (1806) zu einer Gitarrenschule aus. Zusammen mit Wilhelm Klingenbrunner (1782-1850) verfasste er den "Versuch einer vollständigen Anleitung zum Guitarre-Spielen" (1812), in dem er die musikalischen und technischen Grundlagen des "höheren" Gitarrenspiels erläuterte. Seine Bemühungen um die Verbesserung der Gitarrentechnik wurden nur noch vom Meister der Gitarre selbst übertroffen. Mit seiner Schule "Studio per la Chitarra" (1812) setzte Mauro Giuliani die Messlatte für anspruchsvolles Gitarrenspiel bewusst hoch. Seine technischen Studien widmete er denjenigen, "welche bereits mit den Anfangsgründen der Guitarre bekannt" waren und sich das Ziel gesetzt hatten, "alles dasjenige mit Ausdruck vorzutragen, was im reineren Geschmacke für dieses Instrument geschrieben worden" war. Von seinen Schülern verlangte er Eifer, Ausdauer, Fleiß und vor allem tägliches Fingertraining.
Fasst man die skizzierte Entwicklung zusammen, so zeigt sich, dass die wichtigsten Impulse zur Etablierung der sechssaitigen Gitarre als konzertantes Soloinstrument von der Wiener Gitarrenszene ausgingen. In Frankreich setzte sich das neue Instrument erst später durch. Noch 1810 stellte Johann Jakob Staehlin fest: "In Frankreich ist fast durchgängig noch die fünfsaitige Guitarre gebräuchlich, die sechste Saite trift man daselbst gewöhnlich nur auf der sogenannten Lyra, die sich von unserer Guitarre blos durch ihre der alten Lyra nachgeformten Gestalt unterscheidet" (Staehlin 1811, S. 3). Ferdinando Carulli (1770-1841) und Francesco Molino (1774-1847) machten die sechssaitige Gitarre in Paris populär. Carulli reduzierte die Funktion der Gitarre nicht auf die akkordische Begleitung, sondern betrachtete sie von Anfang an als Soloinstrument. In seiner "Méthode Complète pour Guitare ou Lyre" (1810) führte er aus, dass es beim Gitarrenspiel darum gehe, "gleichzeitig eine Melodie und gut durchdachte Bässe in verschiedenen Tonarten zu spielen" (Carulli 1819, S. 4 übers.). Molino ging in seiner "Nouvelle Méthode pour la Guitare" (1813) noch einen Schritt weiter und stellte die Gitarre auf eine Stufe mit dem Klavier: "Es giebt Personen, welche glauben, dass die Guitarre ein beschränktes Instrument sey, das man höchstens zu kleinen Begleitungen des Gesanges vermittelst gebrochener Accorde (Harpeggiaturen) gebrauchen könne. Aber wer so denkt, kennt warlich dies Instrument nicht, das nicht blos zu jeder Begleitung grösserer Gesangstücke, sondern auch für den Vortrag einer Sonate passend ist, die sich, eben so zusammenhängend wie auf dem Clavier, auf demselben spielen lässt. Die Sonaten, die ich zu setzen und nach und nach herauszugeben gedenke, werden zeigen, wie man für dies Instrument schreiben müsse" (Molino 1813, S. 5; ders. 1817, S. 14; 1823, S. 1).
7 Scheidler: Deutschlands erster Gitarrenvirtuose

Das erste Solokonzert für Gitarre, das die Aufmerksamkeit der deutschsprachigen Musikpresse auf sich zog, fand 1806 in Frankfurt am Main statt. Am 22. Januar 1806 traten der Gitarrist Johann Christian Gottlieb Scheidler (1747-1829) und seine Schülerin Marianne Jung (1784-1860) in einem Konzert des Cellisten Johann Gottfried Arnold (1773-1806) auf. Das Konzert begann mit zwei Sätzen aus Mozarts Sinfonie Nr. 39 in Es-Dur, KV 543: „Hier folgten auf jene gewaltigen Sätze, Variationen für zwey Guitarren und ein Violoncell, komponirt von Hrn. Scheidler und gespielt von ihm, Dem. Jung, einer sehr talentvollen Liebhaberin, und Hrn. Arnold. Das sehr angenehme Thema war so mannigfaltig, und mit so viel Kunst variirt, als es von der beschränkten Guitarre kaum zu erwarten stand. Eben so, und mit vielem Geschmack wurde es vorgetragen. Passagen und Läufer, Triller und Harpeggiaturen, hörte man mit grösster Bestimmtheit und Deutlichkeit vortragen; dies musste um so mehr Bewunderung finden, da man, wenigstens hier, gewöhnlich nur zu matter oder süsslicher Begleitung eines Liedes und dgl. sich dieses Instruments zu bedienen pflegt. Die Hauptstimme hatte Dem. Jung, die beyden andern Instrumente waren nur begleitend, ausser dass das Violoncell die Melodie des Themas vortrug. Dem. Jung spielte ihre Partie, so schwierig sie auch war, mit grösster Leichtigkeit und Präcision, und in jedem Betracht als eine Virtuosin. Man hörte nur die Töne, (kein Rauschen, oder sonst etwas nebenbey) und hörte diese nie hart oder schneidend, sondern durchaus sanft und angenehm, im Forte wie im Piano. Dem. Jung ist die Schülerin eines Mannes, der ein so vollkommener Meister dieses lnstruments ist, als man es seyn kann - des Hrn. Scheidler (...). Seine freye Phantasie auf jenen lnstrumenten (seine Guitarre hat sieben Saiten) übertrifft die grösste Erwartung. Ausser einigen eigenen Kunstgriffen, gehören kunstreiche, überraschende Modulationen, Passagen aller Art, einfache und doppelte Triller, unter die gewiss seltenern und schweren Mittel, deren er sich mit Leichtigkeit bedient, seiner Phantasie Raum zu geben und auf die Zuhörer zu wirken. Er spielt selten in Gesellschaft, öffentlich gar nicht mehr; aber dem Freund, dem Künstler, dem Kunstliebhaber, entzieht er das Vergnügen, ihn privatim zu hören, niemals“ (AMZ 8/1806, Sp. 344-346).

Der Konzertbericht ist in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich: Zunächst wird deutlich, dass Scheidler als Berufsmusiker alle Eigenschaften und Fähigkeiten besaß, die Molitor und Guthmann von einem professionellen Gitarristen forderten, nämlich eine virtuose Spieltechnik, Harmonieverständnis und Fantasie. Als er sein Können auf der Gitarre der Öffentlichkeit präsentierte, stellte sich der Erfolg sofort ein. Nicht ohne Lokalstolz berichtete der Frankfurter Korrespondent der "Allgemeinen musikalischen Zeitung" ausführlich über den "erste[en] Lautenist[en] und Virtuos[en] auf der Guitarre in Deutschland". Der Bericht zeigt aber auch eine andere Seite Scheidlers. Der 58-jährige Gitarrist entsprach so gar nicht dem Bild, das man sich von einem Musikvirtuosen machte. Er scheute die Öffentlichkeit, unternahm keine Konzertreisen und ließ seine Werke nicht drucken. Stattdessen widmete er sein ganzes Können dem Gitarrenunterricht und gab seiner besten Schülerin die Möglichkeit, ihr Spiel öffentlich zu präsentieren.
Im November 1806 spielten Scheidler und Jung vor der Kaiserin Joséphine (1763-1814) in Mainz (ZEW 6/1806, Sp. 1159). Am 4. März 1807 traten sie gemeinsam in einem Benefizkonzert zugunsten der Witwe Arnold auf (AMZ 9/1807, Sp. 556f.). Weitere gemeinsame Konzerte fanden nicht mehr statt. Für das Jahr 1811 ist noch ein letztes Gitarren- und Lautenkonzert Scheidlers belegt (ZEW 11/1811, Sp. 1170). Damit war die Geschichte der Gitarre als Soloinstrument in Frankfurt vorerst beendet. Frankfurt war keine Musikmetropole, die bedeutende Gitarrenvirtuosen von außerhalb anzog. Die Stadt hatte nur Scheidler. Bereits im Februar 1813 musste der Korrespondent der "Allgemeinen musikalischen Zeitung" den Niedergang der Gitarre in Frankfurt konstatieren: "Dies Instrument ist überdies bekanntlich gar nicht für grosse Concertversammlungen geeignet, nur ein ganz ausgezeichneter Virtuos kann vielleicht einmal ein grosses gemischtes Auditorium damit allein unterhalten. (Ein solcher ist unser Hr. Scheidler, der aber auch eine reiche Phantasie besitzt, deren Eingebungen er durch Kunst zu ordnen versteht, und Schwierigkeiten überwindet, die unmöglich scheinen.)" (AMZ 15/1813, Sp. 102).
8 Giuliani: der leuchtende Stern am Gitarrenhimmel
Wie schwer es damals für professionelle Gitarristen war, auf der Bühne Fuß zu fassen, zeigt das Beispiel von Paolo Sandrini (1782-1813). Der Oboist und Gitarrist gab am 6. März 1806 gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Luigia Caravoglia (1782-1869) ein Konzert in Prag: „Herr Sandrini, ein sehr talentvoller junger Italiener gab kurz nach ihm [= Anton Eberl] ein Konzert. Er erschien in dreyfacher Gestalt, blies ein Konzert auf dem englischen Horn, eine Polacca auf der Oboe, und spielte sodann noch auf der französischen Guitarre. Dem. Caravoglia füllte die Zwischenräume mit ihrer trefflichen Stimme aus. Dass er das Haus ziemlich gefüllt hatte, dankt er wol minder seinen wahren künstlerischen Vorzügen, als den Lektionen, die er einigen Damen auf der Guitarre gab. Ich hoffe Vergebung, wenn ich schnell über seine Kunstdarstellungen hinweg eile, um zu dem Konzert der Dem. Häser zu kommen“ (AMZ 8/1806, Sp. 542; vgl. ZEW 6/1806, Sp. 336). Wie aus dem Konzertbericht hervorgeht, nutzte Sandrini das Konzert, um den Gitarrenliebhaberinnen leichte Eigenkompositionen vorzuspielen und so den Absatz seiner Werke zu fördern. Die Quittung kam prompt: Der Rezensent befasste sich gar nicht erst mit Sandrinis "Kunstdarstellungen", sondern ging gleich zur nächsten Konzertbesprechung über.
Sandrinis Karriere als Gitarrist verlief offensichtlich wenig erfolgreich. Zwar war er in Prag und später in Dresden als Gitarrenlehrer tätig und veröffentlichte mehrere Werke für Gitarre. In öffentlichen Konzerten trat er jedoch nicht mehr mit der Gitarre auf. Wie die Fachwelt über Sandrinis Werke urteilte, zeigt die folgende Rezension der posthum veröffentlichten Sonate concertante pour Guitarre et Flûte op. 15: „Es lässt sich kein Rühmen davon machen, kann aber mässig geübten Dilettanten, die in ihren mus. Unterhaltungen blos Zeitkürzung suchen, empfohlen werden“ (AMZ 17/1815, Sp. 712).

Mauro Giuliani (1781-1829) verfolgte eine andere Strategie als Sandrini. Er versuchte nicht, sich bei den Gitarrenliebhabern anzubiedern, sondern grenzte sich von Mittelmäßigkeit und Dilettantismus ab. Mit seinem Gitarrenspiel setzte er Maßstäbe, an denen sich andere messen mussten. Entsprechend selbstbewusst trat er auf und entlockte seinem Instrument die damals größtmögliche Virtuosität.
Giuliani unterschied sich nicht nur von Paolo Sandrini, sondern auch von J. C. G. Scheidler. Während Scheidler sich auf den Gitarrenunterricht konzentrierte und nur im engsten Freundeskreis musizierte, trat Giuliani an die Öffentlichkeit. Er gab regelmäßig Konzerte, veröffentlichte zahlreiche Gitarrenwerke und achtete auf ein gepflegtes, modebewusstes Äußeres. Kurz: Er war eine extrovertierte Persönlichkeit, ein Star.
Giuliani verkörperte in vielerlei Hinsicht den Typus des romantischen Virtuosen. Nach seiner Ankunft in Wien im Sommer 1806 zog er schnell die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Die Gitarre war bis dahin nur eine Randerscheinung im öffentlichen Musikleben gewesen. Nun versuchte jemand, die Gitarre von der Peripherie in die Mitte des Musiklebens zu holen. "Was taugt die Gitarre als Konzertinstrument?", "Welchen musikalischen Wert haben Gitarrenwerke?", "Was trägt die Leistung eines Virtuosen zur Musikkunst bei?". Mit solchen und ähnlichen Fragen sah sich die Kritik plötzlich konfrontiert. Die musikalische Fachwelt musste sich mit dem Phänomen "Giuliani" auseinandersetzen, um die Bedeutung der Gitarre und des virtuosen Gitarrenspiels richtig einschätzen zu können.
Der Wiener Korrespondent der "Allgemeinen musikalischen Zeitung" befasste sich in der Ausgabe vom 30. März 1808 ausführlich mit dem Phänomen des Gitarrenvirtuosen. Sein Urteil über Giuliani und das künstlerische Gitarrenspiel wurde wegweisend für die Folgezeit: "Mauro Giuliani ist ein sehr guter Kopf, ein feiner und gebildeter Mann, der vor einiger Zeit, so viel Rec. bekannt, aus Bologna nach Wien kam, und durch interessante Talente von mancherley Art, vornämlich aber durch seine gute Kenntnis und (zum Theil) eigene Ansicht der Musik, so wie durch sein wahrhaft bewundernswerthes, durchaus in Deutschland ihm allein eigenes Spiel eines Instruments, bis dahin, ausser Neapel und einigen andern Hauptstädten des untern und mittlern Italiens, nur als leichtes, galantes Spielwerk, höchstens als angenehmes Accompagnement kleiner, leichter Gesangstücke gebraucht worden war - die Aufmerksamkeit, und dann leicht auch die Gunst fast aller Beschützer der Tonkunst in Wien auf sich zog. Unter denen, die man die elegante Welt nennet, wurde er, wenigstens auf einige Zeit, der musikal. Held des Tages; und man muss gestehn, dass diese Welt ihre Helden nicht selten weit ungeschickter wählt. Seine Kompositionen für die, den dichtenden Musiker so sehr beschränkende Guitarre (...) zeigen Geist und Geschmack, zeigen besonders auch eine neue Ansicht und eigenthümliche Behandlungsart dieses Instruments - welche letztere aber freylich durch sein meisterhaftes Spiel noch besonders klar und einnehmend hervorgehet. Er gebraucht nämlich die Guitarre nicht nur durchaus als obligates, sondern auch als ein Instrument, auf welchem zu einer angenehmen, fliessenden Melodie, eine vollstimmige, regelmässig fortgeführte Harmonie vorgetragen wird. Betrachtet man in dieser Absicht seine Kompositionen, so kann es nicht fehlen (...) - dann findet man überall, es ist möglich, und, hat man's erst in der Gewalt, es ist auch von angenehmer Würkung. Wenn man nun freylich eingestehen muss, dass man durch alles das, und den anhaltendsten, hierauf gerichteten Fleiss, der Sache selbst nach, doch nur höchstens gross im Kleinen werden kann: so wird man doch auch nicht ableugnen können, dass es für jede Kunst und Wissenschaft selbst ein Vortheil ist, wenn sich Männer von Talent, Einsicht und Beharrlichkeit mit einem ganz speciellen Zweige derselben vor allem beschäftigen, und ihren bisherigen Umfang nach dieser einen, wenn auch, im Verhältnis zum Ganzen, nicht allzuwichtigen Seite hin, erweitern; für die aber, welche ihnen dann - wenn auch nicht bis auf die letzte Spitze, folgen wollen, bringen solche Männer immer vielerley Hülfs- und Erleichterungsmittel an's Licht, die allezeit Aufmerksamkeit und Dank verdienen. So ist es denn auch hier (...). Damit mögen denn auch diese Werkchen, (...) und mag ihr Verf., sich begnügen" (AMZ 10/1808, Sp. 427-430).
Über Giuliani selbst hatte der Rezensent nur das Beste zu sagen. Er besitze Geist und Geschmack, Talent, Fleiß und Ausdauer - alles Eigenschaften, die ihn zu einer bis dahin unerreichten Virtuosität auf der Gitarre führten. Weniger schmeichelhaft fiel sein Urteil über Giulianis Instrument aus. Die Gitarre sei ein begrenztes Instrument, auf dem selbst virtuose Hände keine große Kunst hervorbringen könnten. Selbst der größte Virtuose könne auf der Gitarre nur im Kleinen groß werden. Seine Kompositionen für die Gitarre seien letztlich nur "Werkchen". So groß Giuliani als Gitarrenvirtuose auch war, groß konnte er nur im Kleinen sein. Das Urteil des Rezensenten über die "den dichtenden Musiker so sehr beschränkende Guitarre" wurde zu einem festen Topos der Musikkritik, die für das Instrument kaum lobende Worte fand und allenfalls geneigt war, über konzertierende Gitarristen Nettigkeiten zu formulieren.
Mit diesem grundsätzlichen Urteil war die Auseinandersetzung mit dem Phänomen "Giuliani", zumindest aus musikkritischer Sicht, abgeschlossen. Das hinderte aber die zahlreichen Gitarrenliebhaber nicht daran, Giuliani weiterhin als Meister der Gitarre zu verehren. Exemplarisch sei hier aus Maximilian von Schackys Gitarrenschule zitiert, die dazu diente, Amateuren die nötige "Vorbildung" zu vermitteln, um mit Hilfe von Giulianis "Studio per la Chitarra" (1812) das Gitarrenspiel zu erlernen: "Wie das Guitarrespiel durch die Giulianische Methode erhoben ward ist wohl keinem Kenner unbekannt. Nicht allein die Leichtigkeit, hauptsächlich die Güte der Ausführung hat dadurch so gewonnen, daß man den nach älterer Methode Spielenden mit jenem das Instrument nach dieser neueren vortrefflichen Anleitung Behandelnden gar nicht vergleichen kann. Um so mehr verdient der treffliche Giuliani den Dank der Freundinnen und Freunde dieses schönen Instrumentes durch die Herausgabe seiner großen Guitarre-Schule" (Schacky 1824, S. 1; vgl. Karlsruher Zeitung 349/1824, S. 1796).
9 Die nachgiulianische Ära
Als Mauro Giuliani 1819 Wien verließ, hinterließ er eine Lücke, die zumindest im deutschsprachigen Raum nur schwer zu füllen war. Die Gitarre hatte ihren Reiz als Modeinstrument verloren. Der bürgerliche Konzertbetrieb professionalisierte sich zunehmend, und mit der Professionalisierung stiegen auch die Ansprüche an die ausübenden Musiker. In den Musikmetropolen konnten sich professionelle Gitarristen nur noch durch ganz außergewöhnliche Leistungen in öffentlichen Konzerten profilieren. Gleichzeitig wuchs der Kommerzialisierungsdruck auf die Kunst. Es schlug die Stunde der reisenden Virtuosen, die sich geschickt zu vermarkten wussten. Sie reüssierten vor allem in Kleinstädten und in der Provinz, konnten aber auch in größeren Städten mit spektakulären Auftritten auf sich aufmerksam machen. Zu dieser neuen Virtuosengeneration gehörten Luigi Legnani, Carl von Gärtner, Leonard Schulz und Franz de Paula Stoll, aber auch der wenig bekannte Friedrich Karl Ignatz Zoche-Zochetti. In der Brockhaus-Ausgabe von 1827 werden Zoche-Zochetti und von Gärtner als die bekanntesten Gitarristen der Zeit nach Giuliani genannt. In der Ausgabe von 1834 wird auch Sor erwähnt, 1852 schließlich Sor, Zoche-Zochetti und Stoll.
Im deutschsprachigen Raum war es vor allem Luigi Legnani (1790-1877), der eine mit Giuliani vergleichbare Wirkung erzielte. Der Rezensent des Konzertes, das Legnani am 20. Oktober 1822 im Landständischen Saal in Wien gab, sparte nicht mit Lob: "Es ist wohl kaum denkbar, mehr auf diesem beschränkten Instrumente zu leisten, als uns dieser in seiner Art einzige Künstler zu hören gab, und keiner seiner Nebenbuhler, selbst Giuliani nicht ausgenommen, kann mit ihm in die Schranken treten. Man traut seinen eigenen Augen und Ohren nicht, dass ein einzelner Mensch so vollstimmige Sätze hervorzuzaubern im Stande sey; die Ouverture klingt, als ob ein ganzes Orchester von Guitarren sie vortrüge, die Melodie tritt bestimmt und deutlich heraus, und keine der Begleitungsfiguren fehlt. Hatte er im Concerte schon eine unglaubliche Virtuosität entwickelt, so waren die Variationen das non plus ultra der Möglichkeit, der höchste Triumph technischer Fertigkeit“ (AMZ 24/1822, Sp. 796).
Carl von Gärtner (ca. 1799-1835) hingegen konnte mit seinen spieltechnischen Kunststücken, die er am 19. März 1824 im Landständischen Saal vorführte, nicht überzeugen. Die "Wiener allg. Musikalische Zeitung" urteilte in ihrer Ausgabe vom 27. März: "Die Zeit wo man Guitarre Concerte frequentirte ist vorüber, und da schon der berühmte Legnani seine Rechnung hier nicht fand, so konnte Hr. v. Gärtner, der es in der Kunst bei weitem nicht auf den hohen Grad, wie obiger gebracht hat, auf kein zahlreiches Auditorium rechnen, denn wahrhaftig, der Saal war sehr leer. Dergleichen Instrumentenspielereien machen in häuslichen Zirkeln viel Vergnügen, aber im Concertsaale thun sie die entgegengesetzte Wirkung. Demungeachtet hatte auch Hr. v Gärtner seine Verehrer die nach jedem Stücke recht wacker darauf losklatschten“ (WAMZ 12/1824, S. 47).

Der "zwölfjährige" Leonard Schulz (1813-1860), der am 2. Februar 1827 gemeinsam mit Vater und Bruder im Landständischen Saal auftrat, konnte trotz hervorragender Leistungen nicht mehr an die Erfolge Giulianis und Legnanis anknüpfen. Das allgemeine Interesse an der Gitarre hatte sich "sehr vermindert": „Am 2ten, im landständischen Saale: Concert der Brüder Schulz. Nach einer dreyjährigen Kunstreise, auf welcher ihnen die besondere Auszeichnung zu Theil ward, sich während ihres Aufenthaltes in London sechsmal vor dem Könige von England hören lassen zu dürfen, sind nun diese eben so geschickten als liebenwürdigen Knaben, mit Ruhm und Beyfall – hoffentlich wohl auch durch andere Vortheile – belohnt, in's Vaterland zurückgekehrt, und haben heute Rechenschaft abgelegt von ihrem lobenswerthen Streben und den Fortschritten ihrer Ausbildung. Eduard, der ältere, spielte anfangs den ersten Satz des neuen Kalkbrenner'schen Pianoforte-Concertes in Emoll; der deutliche, präcise Anschlag, das reine, besonnene Spiel, eine im hohen Grade errungene mechanische Fertigkeit, Ausdruck und warmes Gefühl characterisiren den jungen, talentvollen Virtuosen, der hierin manchen älteren, wohl schon berühmten Kunstgenossen zum nachahmenswerthen Vorbilde dienen könnte. Nicht minder zeichnete sich der zwölfjährige Leonard in dem brillanten Rondeau für zwey Guitarren von Giuliani aus, wobey ihn sein Vater und Lehrer accompagnirte; abgesehen, dass der Zeitgeschmack die Liebhaberey für dieses Instrument sehr vermindert hat, so bleibt es dennoch interessant, die zarten Finger eine Composition bezwingen zu sehen, die der Autor selbst in seiner glänzendsten Epoche kaum vollendeter auszuführen vermochte. Ausserdem hörte man: Concertvariationen für die hier von Reinlein erfundene Aeol-Harmonica, eine Terz-Guitarre und eine grosse Guitarre; und die beliebte von Mayseder, Moscheles und Giuliani vor Jahren componirte Phantasie: Der Abschied der Troubadours. Der Beyfall war allgemein“ (AMZ 29/1827, Sp. 224f.).

Während sich im deutschsprachigen Raum der Niedergang der Gitarre langsam, aber stetig vollzog, entwickelte sich Paris zum Zentrum der Gitarristik. Anfang 1819 stellte der Musikschriftsteller Georg Ludwig Peter Sievers (1775-1830) den Lesern der "Allgemeinen Musikalischen Zeitung" die Stars der Pariser Gitarrenszene vor: „Ein Herr Carl von Gärtner, aus Cassel gebürtig, der, wie es heisst, ein grosser Guitarrenspieler seyn soll, ist ... in Paris angekommen und wird sich am siebenten Februar im Saale der Menus-Plaisirs hören lassen. Hier, wo man täglich einen Carulli, Plouvier, Meissonnier in Gesellschaften hört, wo der gewaltige Sore noch fortwährend in Andenken lebt und wo es überdem fast in jedem Hause einen höchst geübten Dilettanten auf der Guitarre giebt, wird er mit bedeutenden Schwierigkeiten zu kämpfen haben“ (AMZ 21/1819, Sp. 118).
Der österreichische Komponist Sigismund Neukomm (1778-1858) rühmte im März 1823 Fernando Sor (1778-1839) als den bedeutendsten Gitarristen seiner Zeit: "Sor ist unbezweifelt der erste Guitarre-Spieler der Welt; es ist unmöglich, sich einen Begriff davon zu machen, zu welchem Grade der Vollkommenheit er diess ärmliche Instrument erhoben hat; Ref. hat von ihm die Ouverture zu la chasse du jeune Henry, von Méhul, und den Schluss-Chor des ersten Theils der Schöpfung mit der Fuge recht voll vortragen gehört. Aber Sor's grösste Stärke ist die freye Phantasie: er spielt immer drey- und vierstimmig und nie hört man von ihm das gemeine Arpeggien-Geklimper. Sor lebt gewöhnlich in London und ist dort sehr mit Sing-Unterricht beschäftigt“ (AMZ 25/1823, Sp. 636).
Am 19. Februar 1834 erschien in Bäuerles "Theaterzeitung" eine umfassende Darstellung und Besprechung der nachgiulianischen Ära, die nun zu Ende ging: "Seit Mauro Giuiliani, von dem die neueste Aera im Guitarr-Spiel und Satz datirt werden kann, und der durch seine Studien, so wie durch die drei großen Concerte (die beiden ersteren in A das letztere für Terz-Guitarre in D-dur) sich ein bleibendes Verdienst erworben, dahingeschieden, und sein Sohn und minder glücklicher Nachfolger Michael Giuiliani durch eine glänzende Heirath in Petersburg sich von dem öffentlichen Spiel ganz zurückgezogen, Carulli - der nächst Molino die ältere Schule repräsentirt und von dem das E moll Concert von Viotti für Guitarre arrangirt ist, und der noch auf fünf Saiten spielte, - alt geworden, sind nur noch Stoll, Legnani, Sor, Rigondi, Horetzky, Leutner, Karl von Gärtner, Töpfer in Hamburg und Karl Blume in Berlin hier zu nennen. Von diesen stehen Legnani, Sor und Stoll obenan. Legnani besitzt eine immense Fertigkeit in der linken Hand, die bei ihm auf das Höchste ausgebildet ist; sein Spiel ist aber etwas rauh und reißend und die Compositionen, von denen die Variationen von ihm und dem Wiener Pianisten Leidesdorf mit Quartettbegleitung noch den meisten Werth haben, mehr auf individuelle Fertigkeit als auf Schönheit der Form und Reinheit des Satzes berechnet. Fernand Sor, der früher in London Furore machte, für jede Stunde Unterricht zwei Guineen erhielt und bald ein Liebling der Damen wurde, sah sich genöthigt, wegen eines zärtlichen Abenteuers in einem der ersten Häuser, das von Folgen war, London und England plötzlich zu verlassen und nach Frankreichs winkenden Küste hinüber zu eilen. Er hat sehr viel, aber nur für Wenige geschrieben. Die meisten seiner Compositionen gehen aus G- dur, einer Tonart, die schon an und für sich für die Guitarre minder praktikabel ist, und bewegen sich um eine vollständige Harmonie, so daß man einen Flügel zu hören glaubt. In der Bildung überraschender Modulationen, effectuirender Uibergänge ist Sor ein Meister und übertrifft hier noch M. Giuiliani. Der dritte in diesem Bunde ist Stoll. Von seinem Lehrer M. Giuiliani hat er das höchst correcte, überaus reine, zarte und präcise Spiel, in manueller Fertigkeit übertrifft er ihn sogar; die Ruhe und Bedachtsamkeit, mit welcher dieser Virtuose spielt, die ungemeine Sicherheit, mit welcher er die complicirtesten und schwierigsten Passagen mit einer vollendeten Technik vorträgt, die Weiche, Elasticität und Rundung seines Anschlags, die glänzende Bravour in der Flageolettscala, wo er Paganinische Harmonikaglöckchen wie im Fluge vor uns auftauchen läßt, endlich seine tüchtige und solide musikalische Bildung - die sich in seinen vierstimmigen Sachen überall documentirt, geben ihm von den beiden genannten Guitarristen den Vorzug, da Legnani's Spiel bei aller Fertigkeit nicht angenehm und Sor's zu einseitig und mit Beeinträchtigung des melodiösen Theils verwebt ist. Stolls Pianissimo mit den Uibergängen zum Flageolett ist als wahrhaft vollendet und einzig in seiner Art und die Rapidität der linken wie der rechten Hand meisterhaft zu nennen" (BT 36/1834, S. 144).
Die Zeit nach Giuliani brachte zwar bedeutende Gitarrenvirtuosen wie Legnani und Stoll hervor, konnte aber nicht verhindern, dass die Gitarre als Konzertinstrument an Bedeutung verlor. Reine Gitarrenkonzerte waren in den Konzertsälen ohnehin kaum möglich und fanden entweder in Zusammenarbeit mit anderen Künstlern statt oder der Gitarrist zeigte sein Können auch auf anderen Gebieten als der Gitarrenmusik. Insbesondere deutsche Gitarrenvirtuosen, die mit dem internationalen Standard nicht ganz mithalten konnten, waren gezwungen, in die Provinz auszuweichen, um ihren Lebensunterhalt mit der Musik zu bestreiten. Bürgervereine und Casinogesellschaften, aber auch Gasthäuser als Orte der Geselligkeit spielten dabei eine wichtige Rolle.
10 Der Niedergang der Gitarre

Mit dem Aufstieg der Romantik begann der Niedergang der Gitarre. Welchen Stellenwert die Gitarre in den 1840er Jahren im Wiener Musikleben hatte, zeigt die Rezension eines Konzertes, das Johann Kaspar Mertz (1806-1856) am 28. März 1843 im Musikvereinssaal gab, deutlich. Der Rezensent, ein gewisser Ignaz Lewinsky, schrieb in der "Allgemeinen Wiener Musik-Zeitung": "Als im Jahre so und so viel die Spanier eine Schlacht verloren hatten, fand man 3000 Guitarren auf dem Schlachtfelde. Damals mochte wohl die Blüthenperiode dieses Instrumentes seyn. Wie sich nun die Zeiten ändern! Ich getraue mir jetzt mit einer einzigen Guitarre 3000 Beethoven-Enthusiasten, mit Inbegriff einiger Musikreferenten, die weder von dem einen noch von der andern etwas verstehen, in die Flucht zu schlagen. Das Instrument ist wenigstens bei uns ganz aus der Zeit, selbst die hysterischen Damen, deren einzige Ressource es sonst war, haben es in die Acht erklärt, und ich kenne außer einigen Näherinnen in der Vorstadt nur mehr einen alten Doctor, welcher 'Blühe, Blümchen, blühe' singt und sich mit der Guitarre dazu accompagnirt. Mit dem Interesse an das Instrument mußte natürlich auch das an dessen Virtuosen schwinden, und der leere Saal bei dem heutigen Concerte ist Bürge für die Richtigkeit dieser Behauptung. Nichtsdestoweniger hätte ich Hrn. Merz mehr Theilnahme gewünscht, denn er leistet wirklich Ausgezeichnetes auf seinem Instrumente. Er besitzt eine große Geläufigkeit nebst schönem Vortrag, und nur ein zu häufiges Tempo rubato und ein übermäßiges Ausschmücken seiner Themen mit Beigaben aller Art wäre ihm zum Vorwurfe zu machen. (...) Ihre Majestät die Kaiserinn Mutter beehrte das Concert mit Allerhöch Ihrer Gegenwart" (AWMZ 3 (1843), S. 162).
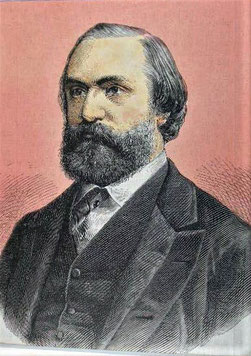
Aufgrund ihres begrenzten Tonumfangs und ihrer geringen Lautstärke konnte sich die Gitarre nicht gegen das Klavier durchsetzen. Als Konzertinstrument wurde sie vom Klavier vollständig verdrängt. Der Musiktheoretiker Eduard Hanslick (1825-1904) machte keinen Hehl aus seiner Überzeugung, "daß dies dürftige Instrument gar nicht in's Concert gehöre" (Hanslick 1869, S. 257). In seiner "Geschichte des Concertwesens in Wien" (1869) resümierte er lapidar: "Gegen Ausgang der zwanziger Jahre sehen wir - ohne Bedauern - die Guitarre und ihre Seitenverwandten aus dem Concertsaal verschwinden" (ebd. S. 258).
Ein Vorwurf gegen die Gitarre war ihre mangelnde Kantabilität. So urteilte die "Grätzer Zeitung" vom 4. März 1837 anlässlich eines Konzerts von Franz de Paula Stoll (1807-1866): "Es gehört eine außerordentliche Energie dazu, mit sechs Saiten, denen doch kein wahrer Gesang zu entlocken ist, so ernsthaft zu spielen, daß am Ende ein so hoher Grad von Virtuosität erreicht wird" (Grätzer Zeitung Nr. 36/1837, Notizen). Und die "Allgemeine Wiener Musik-Zeitung" vom 22. April 1845 bemerkte in ihrer Rezension eines Konzerts von Johann Kaspar Mertz: "Man sollte bedenken, daß sich auf der Guitarre wohl zum Gesange begleiten, nicht aber selbst singen lasse" (AWMZ 1845, S. 191). Ein solcher Vorwurf wog in der Romantik schwer. Und er wurde zu Recht erhoben. Die sechssaitige Gitarre eignete sich damals vor allem für das Non-Legato-Spiel. Ihr Klang erlaubte eine klare Artikulation, verklang aber schnell. Für lyrische Stimmungsbilder war sie nur bedingt geeignet.
Professionelle Gitarristen versuchten der romantischen Klaviermusik etwas Gleichwertiges entgegenzusetzen, indem sie Gitarren mit erweitertem Tonumfang verwendeten. So ließ sich Ferdinando Carulli 1826 eine zehnsaitige Gitarre und Napoléon Coste 1835 eine siebensaitige Gitarre von René Lacôte bauen. Giulio Regondi spielte ab 1840 auf einer achtsaitigen Gitarre von Johann Anton Stauffer. Johann Kaspar Mertz besaß Anfang der 1840er Jahre eine achtsaitige, später eine zehnsaitige Gitarre. Nikolai Petrowitsch Makarow ließ sich von Gottfried Anton Scherzer eine zehnsaitige Gitarre bauen. Auch Luigi Legnani und Johann Padowetz spielten im Laufe ihrer Karriere auf mehrsaitigen Gitarren. Die tiefen Bass- oder Borduntöne galten als besonders romantisch. So berichtete die "Allgemeine musikalische Zeitung" über den Prager Gitarristen Eduard Pique: "Ganz vorzüglich haben wir an ihm seinen Vortrag zu rühmen und die verständige Art wie er die schönen, tiefen, so romantisch klingenden Saiten seines Instruments benutzt“ (AMZ 40/1838, Sp. 800; vgl. AMZ 42/1840, Sp. 417).
Der Versuch der Gitarristen, mit den Klaviervirtuosen ihrer Zeit gleichzuziehen, scheiterte jedoch. Der Geigen- und Gitarrenbauer Gustav Adolph Wettengel (1800-1873) stellte 1869 in seinem "Lehrbuch der Geigen- und Bogenmacherkunst" fest, dass die zehnsaitige Gitarre von der Konzertbühne nahezu verschwunden war: "Soll die Guitarre als Konzertinstrument oder für eigentliche Virtuosen dienen, so hat sie außer den sechs Saiten der gewöhnlichen Guitarre noch vier Begleitsaiten, also im Ganzen zehn Saiten. Indessen ist die Verwendung der Guitarre als Konzertinstrument in neuerer Zeit ziemlich selten geworden und man wendet fast nur die einfachen, meist zur Begleitung des Gesanges dienenden Guitarren an" (Wettengel 1869, S. 291).
